Zunehmende Befürchtungen über einen anhaltenden Abschwung des weltweiten Wachstums liegen wie ein dunkler Schatten über vielen Schwellenländermärkten. Zwar führten die Börsen in den Emerging Markets die Erholung an den Aktienmärkten seit Januar dieses Jahres mit an, doch trotz allem gehen die meisten Händler und Analysten nach einem massiven Verkaufsdruck zum Ende des letzten Jahres nur von einer Zwischenrallye aus.
Dollarkurs entscheidet: Probleme in Schwellenländer nicht gelöst, aber noch lohnt es sich anscheinend…
Darüber hinaus zeigt sich, dass die zugrundeliegenden Wirtschaftsprobleme in der Türkei oder auch in Argentinien keineswegs verschwunden sind oder sich aufgelöst haben.
Reihenweise senken internationale Institutionen wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der Internationale Währungsfonds oder die OECD mittlerweile ihre Wachstumsprognosen. Trotz allem geht aus einer jüngsten Bloomberg-Umfrage hervor, dass Fondsgesellschaften keine weitläufigen Pläne verfolgen, um in nächster Zeit aus Schwellenländeranleihen auszusteigen.
Dennoch gibt sich eine ganze Reihe von Akteuren vorsichtig. Denn wie aus der Vergangenheit wohl bekannt, kann die Situation in den Schwellenländern wie aus dem Nichts heraus ganz schnell kippen. Die weitere Entwicklung des US-Dollars dürfte hierbei ein Zünglein an der Waage sein, während sich das ökonomische Wachstum in vielen Emerging Markets weiter abschwächt.
An den Währungsmärkten flackern zudem immer wieder Krisen auf. Man denke in diesem Kontext nur an die türkische Lira, den venezolanischen Bolivar oder den argentinischen Peso. Auch in Asien stehen die indische Rupie und die indonesische Rupie nach Erholungsperioden immer wieder unter einem verschärften Verkaufsdruck.
Handelskrieg: Verschiedene Interpretationen der Situation in Ost und West
Ob es in den Gesprächen zwischen den USA und China tatsächlich zu einer Einigung über ein neues Handelsabkommen kommen wird, steht nach wie vor in den Sternen. Es ist zuletzt ziemlich ruhig geworden an dieser Nachrichtenfront. Nach wie vor heißt es aus dem Weißen Haus, dass sich die USA und China immer stärker aneinander annäherten. Aus Peking verlautet hierzu bislang so gut wie gar nichts.
Mit einer Ausnahme. Am vergangenen Freitag teilte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua – ein Sprachrohr der Pekinger Regierung – mit, dass die verbleibenden Fragen allesamt hart zu knacken seien. Wie verträgt sich diese Aussage mit dem stets an den Tag gelegten Optimismus des Top-Wirtschaftsberaters von US-Präsident Trump, Larry Kudlow?!
IWF mahnt beide Seiten zur Einsicht, um weiteres Ungemach zu verhindern
Vielleicht wurde es in Washington zumindest als ein kleiner Erfolg verbucht, dass das bilaterale Handelsdefizit der USA mit China im Februar überraschend sank. Beim IWF gibt man sich in diesen Tagen weitaus nüchterner mit Blick auf den Handelskrieg zwischen den USA und China als im Weißen Haus, wo weiterhin auf gute Laune gemacht wird.
IWF-Chefin Christine Lagarde warnte beide Seiten ein weiteres Mal davor, die selbst heraufbeschworene Wunde zu heilen, anstatt die aktuelle Entwicklung in einen sich vertiefenden Handelskonflikt münden zu lassen. Erst im Januar senkte der IWF seinen Ausblick für das weltwirtschaftliche Wachstum. Laut Lagarde könnte schon demnächst eine weitere Abwärtsrevision folgen.
Wasser auf die Mühlen von Zockern – Regulierung wurde in Krisenzeiten versäumt
So schnell kann es gehen. Pervers an der ganzen Sache ist, dass die Akteure an den Aktienmärkten aufgrund der sich verschlechternden Wirtschaftslage abermals auf bald bevorstehende Zinssenkungen der Federal Reserve wetten. In den USA könnte es im Falle einer Rezession gar zu Null- oder Negativzinsen kommen.
Es zeigt sich in diesen Tagen, wie wichtig es gewesen wäre, Banken und Finanzmärkten im Zuge der globalen Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 den Hahn abzudrehen, um mittels einer sich massiv verschärfenden Regulierung vor allem Zockern und Spekulanten ihr Geschäft zu verleiden.
Vor dem Untergang stehende Großbanken hätten durchaus staatlich gestützt werden können. Dabei wäre allerdings nicht zu vergessen gewesen, diese Banken zu zerschlagen und deren Problemsparten in einem geordneten Prozess abzuwickeln. Wenn es zur nächsten Finanzkrise kommt, werden es dieselben Institute und Spekulanten sein, die einmal mehr an vorderster Front dieser Entwicklung stehen werden.
Muss das Kind erst in den Brunnen fallen, um weitere Verschärfung der Ungleichheit zu verhindern?
Haben Regierungen, Notenbanken und Finanzmärkte etwas aus den Boom-and-Bust-Zyklen der vergangenen Jahrzehnte, die sie selbst mit initiiert und heraufbeschworen haben, gelernt? Wohl kaum.
Und deshalb wird es noch weit schlimmer kommen müssen als in den Jahren 2007 bis 2010, um auch den behäbigen Bevölkerungsmassen vor Augen zu führen, dass es so in der Zukunft nicht wird weitergehen können, wenn es nicht zu einer immerwährenden Intensivierung der sozialen Schieflagen in unseren Gesellschaften kommen soll…













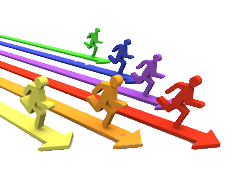
Kommentare
Aber genau das ist der Plan! – Nachzulesen in »Warum schweigen die Lämmer« von Prof. Rainer Mausfeld.
Und daher wird es so kommen wie es kommen muss...
Solange es solche Sauereien wie ungedeckte Leerverkäufe gibt und der Aktienmarkt eigentlich so gut wie nichts mehr mit der Entwicklung der Wirtschaft zu tun hat, wird sich daran auch nichts ändern.